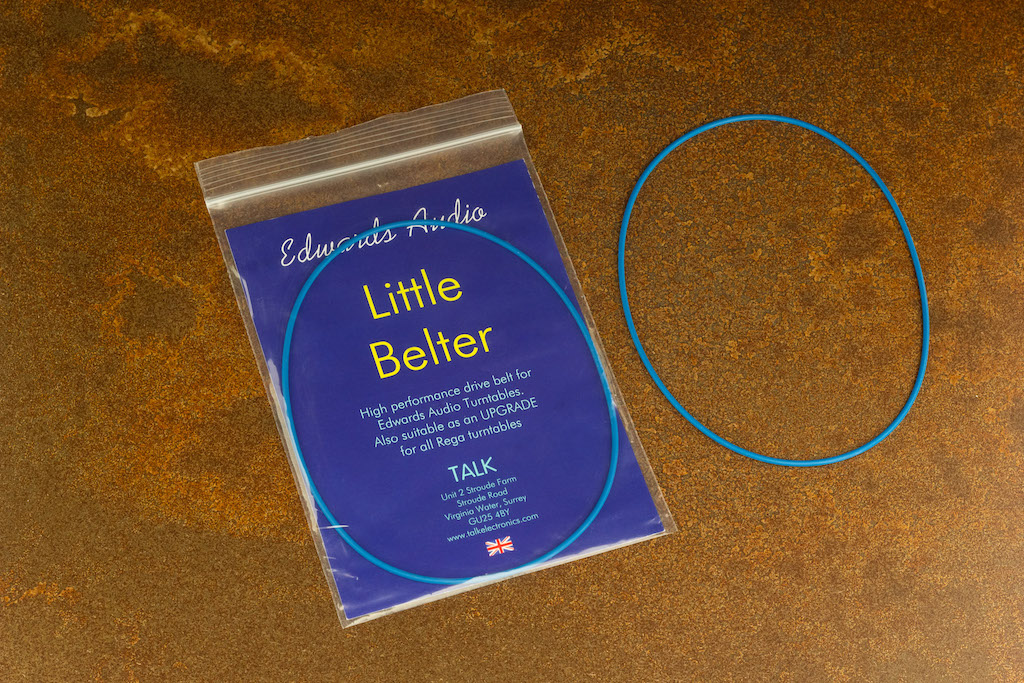Das Sonus faber Sf16 ist das Sinnbild für ein elegantes All-in-one-System. Aus hochwertigsten Materialien gefertigt, exzellent verarbeitet und modern ausgestattet, wäre das Sf16 auch ein ganz heißer Kandidat für einen Design-Award. Stellt sich nur die Frage, ob dieses moderne HiFi-Setup auf den hohen Klangansprüchen standhält, die man an Sonus faber-Produkte stellt.

Sonus faber präsentiert den vielleicht aufwendigsten und luxuriösesten All-In-One-Lautsprecher der Welt, den Sonus faber Sf16.
Im Jahre 1980, also noch vor der offiziellen Sonus-faber-Gründung, machte sich Franco Serblin daran, eines der ersten All-In-One-Systeme der HiFi-Geschichte zu entwickeln. Vielleicht sogar als eines der beeindruckendsten Komplett-Setups des 20sten Jahrhunderts, die Snail. Eine zentrale Tieftonbox inklusive Verstärkereinheit, die sich über zwei an lang ausgestreckten Armen geführten Satelliten zu einem mehr als zwei Meter breiten Drei-Wege-System erstreckt. Ein HiFi-Setup seiner Zeit voraus. Zugleich vielleicht aber auch zu futuristisch, zu raumgreifend und zu teuer, weshalb auch nicht mehr als zehn Exemplare dieses HiFi-Exoten produziert worden sein sollen. Eines davon ist übrigens noch heute im Sonus-faber-Firmensitz im norditalienischen Arcugnano zu bewundern. Zurückblickend war es wohl in erster Linie der außergewöhnliche visuelle Eindruck der Snail, der in der HiFi-Welt für jede Menge Aufsehen sorgte. Ein Design, dessen Ansatz man im Jahre 2015 bei Sonus faber noch einmal zur Vorlage nahm und weiterentwickelte. Mit Mut, kreativer Energie und jeder Menge Knowhow ging man das Projekt an, welches im Jahre 2016 in der Vorstellung des derzeit vermutlich modernsten Konsolen-Lautsprechern gipfelte. Einer, der erneut etwas ganz Besonderes darstellt, sich allerdings wesentlich wohnraumfreundlicher präsentiert, technisch viel mehr zu bieten hat als sein Vorbild und eine Eleganz ausstrahlt, wie es nur ganz wenige Audio-Produkte verstehen.
Unaufdringlich, zeitlos und einfach schön
Eines vorweg: das Sf16 ist meiner Meinung nach eines der hübschesten und optisch gelungensten Wiedergabe-Systeme der HiFi-Geschichte. Der visuelle Eindruck imponiert bis ins kleinste Detail. Sanfte Konturen, wohin das Auge reicht. Die Summe der Ideen spiegelt sich förmlich in einer völlig neuen Charaktersprache wider: Ein Holzkorpus, der sich nahtlos um das Gehäuse zieht und an Eleganz kaum zu übertreffen sein dürfte. Perfekt geschliffen und lackiert, präsentiert sich die meisterhaft verarbeitete Oberfläche wie eine Haut, die die Technik lückenlos umschließt. Dazu das schmale Metallband. Die gebürstete Aluminium-Struktur sorgt für optische Abwechslung. Auch sie zieht sich einmal um den Holzkorpus und passt sich dem edlen Holzkleid perfekt an. Diese Designgebung ist obendrein clever und betont sowohl das Bedienpanel als auch die beiden ausfahrbaren Satelliten visuell, separiert diese aber optisch nicht vom sanft gestreckten Gehäuse. Industriedesigner Dieter Rams sagte einmal „Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail“. Man könnte fast meinen, die italienischen Entwickler und Produktspezialisten hätten sich diese Maxime bei der finalen Gestaltung des Sf16 auf die Fahne geschrieben. Je eine front- und rückseitig aufgesetzte, schwarze Gewebemaske nehmen sich währenddessen der Technik an und verdecken die hier platzierten Lautsprecher-Chassis. Es scheint fast schon selbstverständlich, dass das Sf16 selbst dem kritischen Blick locker standhält. Millimetergenaue Spaltmaße, mustergültige Proportionen, exquisite Rohstoffe, ein nahtloses Holzgehäuse und ein perfekter Materialmix stellen das Design dieses Ausnahmeproduktes sofort in den Fokus. Was für manchen Interessenten ebenso wichtig sein dürfte: Ein Sf16 zu besitzen ist etwas ganz Exklusives. Sonus faber stellt jährlich gerade einmal 200 Stück her.

Der Materialmix ist perfekt aufeinander abgestimmt – die Vererbeitungsqualität exzellent.

Qualität will erhalten werden. Sonus faber legt seinem Sf16 ein Pflegetuch und ein Reinigungsspray bei.
Das Sf16 kann auch Technik
Das Sf16 ist allerdings viel mehr als ein reines Designobjekt. Es hat ebenso alle nötigen Audio-Features an Bord – und noch mehr: Neben eines ausgeklügelten Lautsprecher-Systems, dazu gleich mehr, beherbergt das edle Audio-Schmuckstück einen Vollverstärker mit einer angegebenen Leistung von satten 1.400 Watt. Soweit, so gut. Hinzu kommen aber auch noch ein Streamer und eine vollwertige Vorverstärker-/Steuereinheit – das Sf16 präsentiert sich als vollwertiges HiFi-Setup. Die erste Inbetriebnahme ist ein Kinderspiel. Nachdem das Sf16 mit Strom versorgt und eingeschaltet ist, signalisiert das SF16 mittels Beleuchtung unterhalb des Gehäuses Arbeitsbereitschaft – zugleich fahren die Satelliten ein wenig aus dem Gehäuse. Aus einiger Entfernung scheint es nun fast als schwebe der Konsolen-Lautsprecher in wenigen Zentimetern Abstand über dem Sideboard. Ein Knopfdruck auf die „Wings-Taste“ genügt und die beiden Flügel spannen sich noch ein wenig weiter auf. Über die links nebenan platzierte Taste lassen sich die Satelliten bei Bedarf wieder zurückfahren. Beide Flügel sind übrigens mit jeweils zwei Mitteltonchassis und zwei Hochtönern in Bipol-Anordnung ausgestattet. Bedeutet: jeder Satellit verfügt über ein Zwei-Wege-Setup, das nach vorn abstrahlt und ein identisches, das seine Schallanteile nach hinten abgibt. Die Idee ist clever, denn so soll ein noch räumlicheres und realistischeres Klangbild generiert werden. Je ein Basstreiber in der Front und Rückseite der Haupteinheit sorgen indes für die benötigte Bassunterstützung.

Jeder Satellit ist mit zwei Zwei-Wege-Systemen ausgestattet die ihre Plätze in Front- und Rückseite finden.
Damit wäre die Vorbereitung abgeschlossen, jetzt könnte es auch schon mit der Wiedergabe externer Quellen losgehen. Dazu stellt das Sonus faber-Schmuckstück je einen koaxialen und optischen Digitaleingang und einen analogen Zugang bereit. Damit eignet sich das italienische Audio-Schmuckstück auch für die klassische Musikwiedergabe via CD-Player, Sat-Receiver oder einen externen HiRes-Player. Deutlich umfangreicher wird die Auswahl dann, sobald mein Testgast mit dem heimischen WiFi-Netzwerk verbunden ist. Jetzt ist auch der Zugriff auf freigegebene NAS-Platten, Internetradio-Services und Musikdienste wie Tidal, Spotify, Deezer oder Amazon Music möglich. Alles bequem in die DTS Play-Fi-App integriert und über das Smartphone bzw. Tablet zu steuern. Sie wollen Ihre Lieblingssongs über Ihren Spotify-Account hören? Einfach die Play-Fi-App öffnen, gewünschte Quelle wählen und schon geht’s los, die Spotify-App muss dazu nicht noch zusätzlich hinzugezogen werden. Gleiches gilt in gleichem Maße für die anderen genannten Musikdienste. Komfortable ist das Sf16 also auch. Kein Wunder, dass Sonus faber seinen Konsolen-Lautsprecher als eines der anspruchsvollsten Musiksysteme der Neuzeit bezeichnet.

Zum Lieferumfang des Sf16 gehören eine Fernbedienung, Reinigungstuch, Reinigungsspray, Netzkabel, Anleitung, ein Brand-Book und ein Schraubendreher.
Musik liegt in der Luft
Bevor nun es aber richtig losgeht, sollte man das Sf16 zunächst mit dem eigenen WLAN-Netzwerk bekannt machen, schließlich wollen wir ja auch die modernen Features dieses All-In-One-Setups kennen lernen. Was zunächst vielleicht kompliziert erscheinen mag, ist in Wahrheit in wenigen Minuten erledigt.
1. DTS Play-Fi-App runterladen
2. WIFi-Knopf auf Geräterückseite etwa 5 Sekunden gedrückt halten
3. Netzwerk „PlayFi-Device xxx“ auswählen und App öffnen
4. In App das heimische Netzwerk auswählen und Passwort eingeben
5. Fertig!

Angst vor der Einrichtung muss man nicht haben. Wenn Sie Ihr eigenes Hausnetz und das zugehörige Passwort kennen, ist diese in wenigen Minuten erledigt.
Spannweite für Raum und Tiefe
Das Sf16 steht nun an seinem finalen Platz und ist mit dem Heimnetzwerk verbunden. Zeit also, den schönsten Teil meines Checkups, den Praxistest folgen zu lassen. Dem Druck auf die Power-Taste folgt die Illumination der Gerätebasis. Zugleich werden die Satelliten ein Stück aus dem Gehäuse herausgefahren. Das Sf16 ist also betriebsbereit. Für die bestmögliche Soundperformance sollten die Flügel aber vollständig ausgefahren sein. Dazu genügt nun ein Fingertipp auf die „Wings“-Taste der Fernbedienung. Anschließend fahren die beiden Zwei-Wege-Satelliten unter leichtem Surren sanft aus dem Gehäuse. Ein Vorgang, dem man gern zuschaut und der die Handarbeitskunst und das Designverständnis der italienischen Ingenieure absolut nachvollziehbar macht. Das Sf16 ist einfach edel und fängt mich aufgrund seiner Optik und der coolen Satellitenlösung schon ein, bevor die ersten Töne zu hören sind. Apropos Töne: ich habe das schicke All-In-One-System zwar schon mehrfach auf Messen bewundert und auch gehört, allerdings noch nie zuvor unter mir gut bekannten Voraussetzungen wie in unserem Hörraum. Ich bin gespannt …
Die Klangprüfung starte ich mit einem Song, den ich gern zu Testzwecken nutze und entsprechend gut kenne: „Nightclubbing“ von Grace Jones in 96-Kilohertz-Auflösung. Ein zunächst einfach aufgebaut erscheinendes Stück, das im weiteren Verlauf jedoch jede Menge kleinerer Einzelheiten offenbart. Bis in den letzten Winkel akustisch beleuchtet, spannt sich die Bühne bereits nach wenigen Augenblicken vor mir auf. Der Raum füllt sich mit Musik, die akustische Darstellung ist breit, hoch und auch tief gestaffelt. Mittendrin die Stimme der Jamaikanerin. Imponierend aber niemals aufdringlich wird sie in völliger Klarheit in den Raum entlassen. Was sich in diesem Zusammenhang schnell bemerkbar macht: das Sf16 ist kein Schönspieler. Es korrigiert nichts sondern deckt jede Stärke und jede Schwäche der Aufnahme schonungslos auf. Dabei zeigt es sich speziell im Hochton- und oberen Mittenbereich als klar auflösend – das wiederum ohne jeden Anflug von Schärfe. Ähnlich zeigt sich das Klangbild in den Mitten und im Grundtonbereich. Alles sehr schön ausgewogen. Die Bezeichnung „Neutral“ trifft es vielleicht nicht ganz. Der schicke Konsolen-Lautsprecher geht hier zwar etwas wärmer zu Werke, neigt aber niemals dazu, die warme Decke über den Song zu legen. Das kommt dem Temperament meines Testgastes zugute, der sich zugleich auch als erstaunlich impulsstark zeigt. Letzteres ist eindeutig auch den enormen Leistungsreserven zu verdanken, die dem Sf16 ausreichend Headroom bieten. Exemplarisch sei hier die einleitende Basslinie erwähnt, die mit jeder Menge Durchzug und Leben reproduziert wird, aber nie aufdringlich, überladen oder verzerrt und nervig daher kommt.

Sehr edel gemacht. Die Satelliten werden auf filigranen Alu-Schienen mit Carbon-Inlay geführt.
Ehrlichkeit & Atmosphäre
Das Klangbild wirkt insgesamt sehr harmonisch, passt zueinander und „fliesst“ sozusagen in die richtige Richtung. Dass sich das Sonus-faber-Setup eine Etage tiefer leicht zurückhält, sollte erwähnt werden, ist nach meinem Geschmack aber keineswegs negativ zu bewerten. Statt sich im tiefsten Basskeller aufzureiben, verzichtet das Sf16 auf den Abstieg in allertiefste Gefilde und macht stattdessen das was es kann – und zwar in nahezu perfekter Art. Wer nun glaubt, dass es ihm an Bassleistung fehlt, der irrt. Gemessen an seinem Volumen bietet das bildhübsche Komplettset aus Italien schon jede Menge Tiefgang, es stellt ihn nur nicht übertrieben zur Schau. Von dieser Abstimmung profitiert letztendlich die gesamte Klangcharakteristik. Der Sound wirkt körperhaft, temperamentvoll und eher schlank statt zu voluminös.
Im Anschluß steht nun Mrs. Carol Kidd mit “Is`nt It A Pity” in der Playlist. Ein eher ruhiger Song, der nur so vor Gefühl und Schmelz strotzt. Eine Kombination, die für manch HiFi-Lösung eine echte Herausforderung darstellt und gern gelangweilt bzw. dumpf dargestellt wird. Über das Sf16 wiedergegeben bietet der Song vom ersten Moment an eine wohlige Atmosphäre. Jeder Tastendruck auf das begleitende Piano sitzt, während die unverkennbare, jederzeit präsent dargestellte Stimme der britischen Jazz-Ikone mittig zwischen den Satelliten zu schweben scheint. Alles nicht vordergründig spektakulär, dafür aber intensiv, einfach nur korrekt und exakt – ebenso wie vom Toningenieur gewollt. So macht Musikhören Spaß und strengt auch nach mehreren Stunden nicht an.
Es gibt aber eine weitere Besonderheit: Punch, Volumen, Agilität – all das bietet dieses All-In-One-Setup auch unter niedrigen Pegeln. Eine Soundperformance, die nur ganz wenige HiFi-Systemen in dieser Klangqualität beherrschen. Nochmals überraschender wird es nach der folgenden, deutlichen Lautstärkeerhöhung. Jetzt wird es lauter, sonst passiert nichts. Sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Während die Pegelerhöhung bei manch anderem Audio-Produkt mit Härte, Schärfe oder wummernden Bässen einhergeht, verändern sich die Klangmerkmale beim Sf16 auch deutlich oberhalb der Zimmerlautstärke kaum und behalten den zuvor beschriebenen Charakter bei. Überhaupt zeigt sich mein Testgast erneut als außerordentlich leistungsstark und beweist, das auch vergleichsweise kompakte HiFi-Setups durchaus beeindruckende Kraftreserven mitbringen können – ohne übertrieben aufgebläht zu klingen. Im Gegenteil, die Soundperformance des Sonus faber-Konsolenlautsprechers wirkt auch unter höheren Pegeln unangestrengt, gelassen und souverän.

Die zum Lieferumfang gehörige Fernbedienung übernimmt das edle Design des Sf16 und unterstreicht den hohen Sonus-faber-Anspruch.
Fazit
Besser und treffender kann man den Sonus-faber-Anspruch nicht definieren. Das Sf16 bietet ein Design, an dem man sich einfach nicht sattsehen kann. Sanfte Rundungen, perfekte Proportionen und der hochedle Materialmix machen das Sf16 schon jetzt zu einem Meilenstein der HiFi-Geschichte. Aus erlesenen Materialien gefertigt, exzellent verarbeitet und modern ausgestattet ist das Sonus-faber ist aber viel mehr als ein bildhübsches Design-Objekt: Souverän, fein aufgelöst, bei Bedarf mit reichlich Punch und überraschenden Leistungsreserven, klingt dieses All-In-One-System auch noch deutlich besser, als man es bei seiner Größe erwarten würde.
Klasse: Referenzklasse
Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten
| Modell: | Sonus faber Sf16 |
|---|---|
| Produktkategorie: | All-In-One-System (Konsolen-Lautsprecher) |
| Preis: | 9.999,00 Euro |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Ausführungen: | - Holz/Aluminium |
| Vertrieb: | Audio Reference, Hamburg Tel.: 040 / 53320359 www.audio-reference.de |
| Abmessungen (HxBxT): | - Geschlossen: 224 x 640 x 408 mm - Geöffnet: 256 x 1040 x 408 mm |
| Gewicht: | 25 kg |
| Eingänge: | - Cinch - koaxial digital - optisch digital - WiFi |
| Unterstützte Audio-Dateiformate: | - MP3 - M4A - AAC - FLAC - WAV |
| Maximale Samplingrate/ Auflösung | - Lossless Wiedergabe bis 16Bit/44,1kHz - volle Kompatibilität mit high-resolution Musik bis 24Bit/192kHz |
| Leistung: | 1.400 Watt (Herstellerangabe) |
| Lieferumfang: | - Sf16 - Fernbedienung - Netzkabel - Anleitung - Brand-Book - Garantiekarte - Reinigungsspray - Reinigungstuch - Schraubendreher |
| Besonderheiten: | - ausgezeichnete Verarbeitung - erlesene Materialien - ausfahrbare Satelliten - Streaming per LAN oder WLAN - HiRes-Streaming der Dienste Tidal, Spotify, Deezer, Qobuz - Zugang zu Internet-Radiostationen über vTuner |
| Benotung: | |
| Klang (60%): | 1,1 |
| Praxis (20%): | 1+ |
| Ausstattung (20%): | 1,0 |
| Gesamtnote: | 1,0 |
| Klasse: | Referenzklasse |
| Preis-/Leistung | sehr gut |
Der Beitrag Sonus faber Sf16 – Design-Meilenstein und All-In-One-HiFi-Prunkstück erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.